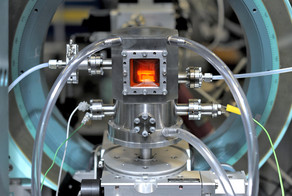Mehr als Vater, Mutter, Kind
- Forschung
- mundo

Familien jenseits der heterosexuellen Norm oder Personen, die eine solche gründen wollen, erleben in Deutschland soziale, institutionelle und rechtliche Hürden. Prof. Mona Motakef und Leoni Linek haben solche Familiengründungen aus einer soziologischen Perspektive untersucht.
Was ist eine Familie? Die meisten Personen denken instinktiv an Vater, Mutter und ein Kind oder mehrere leibliche Kinder. Doch in der Realität sind die Familienkonstellationen viel diverser und bunter. Neben lesbischen, schwulen und trans Paaren, die Familien gründen, gibt es auch queere Alleinerziehende oder Mehrelternfamilien, welche wiederum ganz unterschiedlich aussehen können: Polyamore Konstellationen gibt es ebenso wie Co-Parenting, beispielsweise gemeinsam durch ein lesbisches und ein schwules Paar. Bislang wurden solche Konstellationen im deutschen Sprachraum soziologisch kaum erforscht. Prof. Mona Motakef und Leoni Linek haben diese verschiedenen Familien in ihrem Forschungsprojekt „Ambivalente Anerkennungsordnung. Doing reproduction und doing family jenseits der ‚Normalfamilie‘“ untersucht, um herauszufinden, wie sie sich gründen und welchen Hürden – ob rechtlicher, institutioneller oder sozialer Art – sie begegnen.
„In vielen Bereichen sind queere Lebensformen zunehmend rechtlich mit heterosexuellen Lebensformen gleichgestellt, beispielsweise in der Verwaltung oder in der Erwerbsphäre“, sagt Prof. Motakef. „Aber im vermeintlich privaten Bereich halten sich Ungleichheiten sehr hartnäckig.“ Erhoben hat sie die Informationen in zwei Schritten: Auf eine Literaturstudie, die sich den rechtlichen Regulierungen der Familiengründung bei LGBTIQ-Familien widmete, folgten insgesamt 15 explorative, qualitative Interviews. Deutlich wurde im Rahmen des Forschungsprojekts insbesondere eins: dass Paare jenseits der Hetero-Norm sich bei einer Familiengründung zahlreiche Fragen stellen müssen, die Hetero-Paaren in der Regel nicht begegnen.
Rechtliche Hürden für nicht-biologische Eltern
Beginnend mit derjenigen, die ganz am Anfang steht: Wer soll das Kind austragen? In nicht heterosexuellen Konstellationen ist die Familiengründung viel aufwändiger. Denn anders als bei Mann und Frau, wo sich die Frage, wer überhaupt schwanger wird, gar nicht erst stellt, ist diese bei anderen Konstellationen oft die erste und vielleicht auch die schwierigste. Der Grund dafür sind vor allem rechtliche Konsequenzen. Denn sobald nicht-biologische Eltern ins Spiel kommen, ist die Anerkennung der Elternschaft kompliziert. Das zeigt auch das Beispiel eines lesbischen Paares aus Motakefs Studie: „Die beiden haben sich im Voraus Gedanken gemacht, wer sich in der prekäreren Situation befindet und daher die leibliche Elternschaft brauchen könnte, um vor dem Jugendamt Bestand zu haben“, sagt Motakef. Faktoren wie eine unklare Erwerbssituation oder sogar geschiedene Eltern spielten hier eine Rolle. Die Frauen antizipierten also die Kriterien des Jugendamts und trafen darauf basierend die Entscheidung, wer schwanger wird und wer adoptiert.
„Viele denken, dass das Adoptionsverfahren bei lesbischen Müttern eine Formalie ist und das Jugendamt keine Zweifel hat. Immerhin sind das oft Personen mit hoher Bildung und materiell sicheren Verhältnissen“, fährt Motakef fort. „Aber viele lesbische Paare haben berichtet, dass sie vom Jugendamt regelrecht durchleuchtet wurden – so musste eine Frau, die adoptieren wollte, zeigen, dass sie das Kind wickeln kann.“ Eine Situation, der die meisten Hetero-Paare nicht ausgesetzt seien.

Bei einem an der Studie teilnehmenden trans Paar wurde die Person schwanger, die rechtlich als Mann anerkannt werden wollte. Aufgrund der rechtlichen Situation musste sie sich jedoch zwischen Transition und Schwangerschaft entscheiden. „Die Entscheidung für die Schwangerschaft bedeutete gleichzeitig eine Entscheidung gegen die Transition“, sagt Leoni Linek. „Zum damaligen Zeitpunkt bestanden für trans Paare, die Eltern werden wollten, erhebliche Hürden durch Klauseln des Transsexuellengesetzes, wonach man 300 Tage nach der Geschlechtsumänderung kein Kind bekommen durfte, da ansonsten die Namensänderung hinfällig würde.“
Kompliziert wird es auch, wenn mehr als zwei Personen Elternschaft anstreben, beispielsweise wenn ein lesbisches und ein schwules Paar gemeinsam ein Kind bekommen möchten. In Deutschland kann ein Kind jedoch nur zwei rechtliche Eltern haben. In einer Mehrelternfamilie haben die „inoffiziellen“ Eltern keinerlei Elternrechte – die beteiligten Personen müssen entscheiden, wem dieses Los zufällt.
Suche nach der passenden Reproduktionsmethode
Mit der Frage, wer schwanger wird, geht auch die Frage nach dem wie einher. In vielen Fällen müssen Paare jenseits der Hetero-Norm auf Reproduktionstechnologien zurückgreifen. Lesbische Paare nutzen oft eine Samenspende, häufig auch im privaten Kreis. „In unserem Sample erfolgte eine Samenspende an ein lesbisches Paar über jemanden, den sie im Internet gefunden hatten – eine rechtliche Grauzone, anders als bei Samenbanken, bei denen stärkere rechtliche Regelungen existieren“, sagt Linek. So haben Samenbanken in Deutschland beispielsweise die Verpflichtung, die Identität des Spenders offenzulegen.
Ein anderes lesbisches Paar, das im Rahmen der Studie interviewt wurde, nutzte die ROPA-Methode. ROPA steht für „Reception of Oocytes from Partner“, auf Deutsch „Empfang von Eizellen der Partnerin“. Dabei wird die befruchtete Eizelle der einen Frau ihrer Partnerin eingesetzt. Somit ist die erste Frau die genetische Mutter, die zweite die austragende und somit auch die rechtliche Mutter. „Die Methode ist für lesbische Paare sehr attraktiv, da so beide Frauen körperlich teilhaben können“, sagt Linek. Dies war auch für das Paar aus der Studie ein ausschlaggebender Punkt: „Sie wollten offensiv mit dem Vorwurf umgehen, dass eine von ihnen keine ‚richtige‘ Mutter sei“, sagt Motakef. „Die Methode war für sie wie eine Trumpfkarte, die ihnen beiden bescheinigt, leibliche Eltern zu sein.“ Dafür nahmen die Frauen auch in Kauf, die Prozedur im Ausland durchführen zu müssen, da sie in Deutschland als Form der Leihmutterschaft gilt und somit verboten ist.


Lesbische Frauen haben trotzdem bessere Möglichkeiten, eine Familie zu gründen, als schwule Paare. So sind beispielsweise Leihmutterschaften hierzulande nicht erlaubt. In Deutschland gibt es daher viele lesbische, aber kaum schwule Paare, die eine leibliche Elternschaft realisiert haben, abgesehen von jenen, die aus früheren heterosexuellen Beziehungen bereits Kinder in die Partnerschaft mitgebracht haben. Seit der Gleichstellung der Ehe in Deutschland für Homosexuelle im Jahr 2017 ist es schwulen Vätern immerhin erlaubt, Kinder zu adoptieren.
Kampf um Anerkennung in der Gesellschaft
Die Soziologinnen untersuchten jedoch nicht nur die Familiengründung – das Doing Reproduction – sondern auch das Doing Family. „Familie ist eine Herstellungsleistung. Doing Family ist also das, was wir tun, um Familie zu sein“, sagt Prof. Motakef: Sich umeinander kümmern, füreinander da sein, Pflichten übernehmen. Das Doing Family sei letztendlich die soziale Elternschaft, also das, was ein Familienleben ausmache, und könne völlig losgekoppelt sein von der reinen Zeugung eines Kindes: „Eltern sind letztendlich die Personen, die sich im Alltag praktisch mit den Kindern beschäftigen.“ Und das sind in queeren Konstellationen oft auch Personen, die keine genetischen Eltern sind.
„Viele der Familien, die wir interviewt haben, betonten auffällig, dass sie ganz normale Familien seien.“ Mona Motakef
Doch Familien außerhalb der Hetero-Norm müssen häufig einen größeren Aufwand betreiben, um von Außenstehenden als Familie anerkannt zu werden, während Hetero-Familien keinem solchen Rechtfertigungsdruck unterliegen. „Viele der Familien, die wir interviewt haben, betonten auffällig, dass sie ganz normale Familien seien“, sagt Motakef. „Eine Dreier-Elternkonstellation wies darauf hin, dass sie bürgerliche Werte vertreten und jeden Sonntag Braten essen. Es liegt nahe, dass ihnen die Normalität ihrer Familienkonstellation latent abgesprochen wird und sie ihre Normalität mit diesen Geschichten unterstreichen möchten. Queere Familien müssen also einen großen Aufwand betreiben, damit man ihnen glaubt, dass sie ‚normal‘ sind.“ Im Rahmen der Interviews hörten die Forscherinnen auch Geschichten, die ihnen zu denken gaben: So habe ein lesbisches Paar nach ihrem Umzug in einen Vorort für alle Nachbarn einen Kuchen gebacken, weil sie der Ansicht waren: „Wenn sie wissen, wer wir sind, dann hassen sie uns weniger.“
Die Forschung von Mona Motakef und Leoni Linek offenbart, dass sich die voranschreitende rechtliche Gleichstellung von Familien jenseits der Hetero-Norm im gesellschaftlichen Umgang noch längst nicht etabliert hat. Für die beiden ist es daher ein Anliegen, dass der Familienbegriff auch in der Forschung stärker geöffnet wird und nicht nur Vater, Mutter und Kind umfasst.

Mit Spannung blicken sie auch auf die Umsetzung des Koalitionsvertrags der neuen Bundesregierung, in dem eine Änderung des Familienrechts vereinbart wurde. Unter anderem soll das kleine Sorgerecht für soziale Eltern ausgeweitet und zu einem eigenen Rechtsinstitut weiterentwickelt werden, das im Einvernehmen mit den rechtlichen Eltern auf bis zu zwei weitere Erwachsene übertragen werden kann. Vereinbarungen zu rechtlicher Elternschaft, elterlicher Sorge, Umgangsrecht und Unterhalt sollen schon vor der Empfängnis möglich sein, und wenn ein Kind in die Ehe zweier Frauen geboren wird, sind automatisch beide rechtliche Mütter des Kindes. Zudem soll die Ehe kein ausschlaggebendes Kriterium bei der Adoption minderjähriger Kinder sein.
„Mit diesen weitreichenden Reformen hatte ich nicht gerechnet. Das ist eine Abkehr von Familienpolitik wie wir sie kannten, die sich bislang immer am männlichen Ernährer-Modell orientiert hat“, sagt Prof. Mona Motakef. Leoni Linek betont, dass die Schließung der schon lange bestehenden rechtlichen Lücken auch für den Staat einen großen Vorteil bietet, da er bislang die Personen in „anderen“ Familienkonstellationen nicht in die Pflicht nehmen konnte, für das Kind zu sorgen – nicht zuletzt finanziell. Kritisch sieht sie, dass die im Koalitionsvertrag angestrebte Verantwortungsgemeinschaft sehr abgespeckt sei und kein Namens-, Aufenthalts- oder Sorgerecht umfasst.
Die explorative Studie hat für Mona Motakef und Leoni Linek verschiedene Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsfragen ergeben: Themen wie Normalitätsvorstellungen von Mutterschaft, innerfamiliäre Arbeitsteilung und finanzielle Arrangements in Nicht-Hetero-Familien oder Queer Ageing sind in Deutschland noch kaum erforscht worden.
Text: Adriane Koller
Zur Person:

Prof. Mona Motakef ist seit Oktober 2020 Professorin für Soziologie der Geschlechterverhältnisse an der Fakultät Sozialwissenschaften. Sie studierte Sozialwissenschaften an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und promovierte 2010 an der LMU München. Nach ihrer Postdoc-Phase am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, der Universität Duisburg-Essen, dem King’s College London und der Universität Tübingen war sie Gastprofessorin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen Geschlechterverhältnisse in der Erwerbs- und Sorgearbeit, Anerkennung und Liebe bei prekär Beschäftigten sowie vielfältige Familien und Elternschaft jenseits der Heteronormativität.

Leoni Linek ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Prof. Mona Motakef. Sie studierte Economics and Philosophy an der University of York und absolvierte im Anschluss den M.Sc. in Economics for Development an der University of Oxford. Aktuell promoviert sie an der Humboldt-Universität zu Berlin zum Thema „Gemeinsam frei sein. Intime Zweierfreundschaften in der neuen Mitte – ein Sehnsuchtsort jenseits der romantischen Liebe?“.
Dies ist ein Beitrag aus der mundo, dem Forschungsmagazin der TU Dortmund.